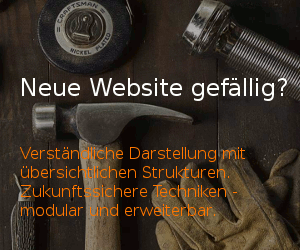Auch das Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen (ITA) macht auf diesem Gebiet immer wieder Schlagzeilen. Gemeinsam mit der Universität Tampere (Finnland) wurden erst kürzlich hochporöse textile Strukturen geschaffen, eine Art Gerüst für die Züchtung körpereigener Gefäßprothesen aus patienteneigenen Zellen. Im wirtschaftsnahen TITV Greiz, Institut für Spezialtextilien und flexible Materialien in Thüringen, wird u. a an der Integration von Mess- und Stimulationsfunktionen in Textilien gearbeitet. Im Ergebnis können Vitalparameter erfasst werden oder über Elektrostimulation Muskeln gezielt aufgebaut werden.
In den international renommierten Hohenstein Instituten bei Stuttgart war es Forschern zudem gelungen, Stammzellen auf textilen Trägerschichten wachsen zu lassen und sich damit der sich selbst regenerierenden Herzklappe einen entscheidenden Schritt zu nähern. Für eine „therapeutisch aktive Wundauflage mit Drug-Delivery-Funktion“ aus demselben Haus wurde erst im Oktober ein Team um den Biologen Gregor Hohn mit dem Innovationspreis „textil+mode 2009“ ausgezeichnet. Die Innovation setzt kontrolliert Wirkstoffe zur Heilung chronischer Wunden frei – allein in Deutschland leiden darunter vier Millionen Menschen.
„In der Medizin werden Textilien besonders vielfältig eingesetzt und mit vielen innovativen Funktionen ausgestattet“, weiß Dr. Michael Doser, Stellvertretender Direktor und Leiter Entwicklung Biomedizin des ITV in Denkendorf. „Anwendung finden sie als Medizintextilien nicht nur im stationären Bereich, sondern auch in der Diagnostik und Therapie. Textile Implantate (z.B. Herniennetze, Gefäßprothesen u. a. m.) werden vom Körper besonders gut angenommen, weil die mechanischen Eigenschaften der textilen Fasern gut an die Fasern im Gewebe angepasst werden können.“
Kooperation mit Defiziten
Dem herausragenden Stellenwert des Healthcare-Sektors trägt das Forschungskuratorium Textil mit einem seiner Leitthemen Rechnung, mit denen die Prämissen für die Zukunftsfähigkeit der textilen Inlandsproduktion bis 2015 formuliert werden: „Im Verbund mit der Medizintechnik, der Biotechnologie, der Pharmakologie und den Pflegedienstleistungen können Textilien bezüglich Effizienz und Innovation einen hervorragenden Beitrag leisten und die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens unter Berücksichtigung beherrschbarer Kosten potenzieren.“
Die übergreifende Kooperation zwischen den Wissenschaften ist in der textilen Forschung längst Selbstverständlichkeit. Bei den Kontakten zur Praxis sieht Dr. Klaus Jansen, Geschäftsführer des Forschungskuratoriums Textil e.V., jedoch noch Defizite. Aus seiner Sicht müssten sich Textilforscher und Mediziner noch mehr austauschen. Nur so können die „Textiler“ zukunftsweisende Entwicklungen für die Gesundheits- und Medizinbranche bedürfnisgenau mitgestalten.
www.textilforschung.de